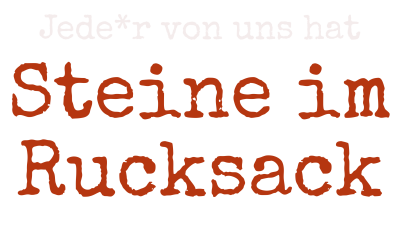Ich habe lange nicht verstanden, warum Organisationen wie das Bündnis gegen Depression und die Depressionsliga nicht mit mir zusammenarbeiten wollen – obwohl ich hier wirklich viel versucht habe. Ich hatte dahingehend schon lange eine sehr starken Verdacht, der heute dann auch durch ChatGPT genährt bzw. bestätigt wurde: ich liefere einfach nicht das bequeme Bild, das sie gerne erzählen.
Nicht nur sie.
Sondern wahrscheinlich der Großteil der Menschen, die öffentlich mit Depressionen umgehen.
Nämlich, dass Depressionen eine Krankheit sind, die uns aus dem Nichts befällt. Gegen die man selbst machtlos ist und darum nichts weiter tun kann, als sich über das Aushalten dieses Schicksals auszutauschen.
Und eben nicht, dass sie meistens ein komplexes Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren sind. Bei dem es darum gehen sollte, die Ursachen zu ergründen und zu bearbeiten.
Das ist ein Problem.
Und zwar, weil es dazu führen kann, dass Betroffene nie lernen, die wirklichen Ursachen ernsthaft aufzuarbeiten. Weil die Diskussion meistens einfach damit aufhört, dass man krank ist.
Dieser Ansatz verhindert dann, dass wir als Gesellschaft irgendwann mal wirklich verstehen lernen, wie Depressionen entstehen, welchen Anteil wir selbst daran haben und wie wir nachhaltig gesund damit umgehen lernen könnten.
Dass Depressionen eine Krankheit sind, steht im Zentrum vieler Initiativen, die sich in diesem Umfeld bewegen. Die sich dann damit beschäftigen, sich gegenseitig zu bestärken, dass man dieses schwere Schicksal gemeinsam aushalten muss.
Das ist einerseits wichtig und schön, weil es Menschen zusammenbringt, die sich Kraft geben.
Andererseits halte ich es aber auch für ziemlich schädlich.
Und zwar, weil es Menschen eine Ausrede dafür gibt, keinen wirklichen und schmerzhaften Blick auf die echten Hintergründe zu werfen.
Und damit gibt es der ganzen Gesellschaft eine viel zu einfache Lösung für ein viel zu komplexes Problem.
Seit ich meine eigene Depression aufgearbeitet habe und damit viele Dinge ans Licht der Öffentlichkeit gebracht habe, die für andere überfordernd, schwer einzugestehen oder schlicht unangenehm waren, erfahre ich Ausgrenzung.
Von meiner Familie, die einfach behauptet, dass das, was ich aufgeschrieben habe, alles nicht stimmen würde. Oder dass man ja auch ihre Seite betrachten müsste. Oder dass ich eben einfach ein aggressiver Störenfried sei und an dieser ganzen Situation entsprechend selbst schuld.
Von öffentlichen Institutionen, für die das Thema ganz offenbar zu komplex oder zu anstrengend ist. Oder weil da eben selbst Menschen drin sitzen, denen es unangenehm ist, genauer auf die eigene Geschichte zu schauen. Und an manchen Stellen wurde ja auch deutlich, dass die vielleicht ganz froh darüber sind, dass sie mit einem Krankheits-Sticker eine Entschuldigung für das eigene Fehlverhalten bekommen.
Würde ich mich jetzt aber hinstellen und sagen, dass festgestellt wurde, dass ich etwas krank im Kopf bin und da irgendwas schief gepolt ist, dann wäre ich wahrscheinlich ein akzeptierter Teil meiner Familie, könnte auf Bühnen der Depressionsliga und des Bündnisses gegen Depression stehen und mir Anerkennung und Mitleid für meinen Umgang mit der Krankheit abholen und müsste nicht als verzweifelter Einzelkämpfer das unglaublich schmerzhafte Gefühl haben, als würde ich irgendeinen Blödsinn erzählen und als wollte mir keiner zuhören.
Das kann doch nicht sein.
Erstmal vorneweg: es ist wichtig, dass wir Depressionen als Krankheit ansehen. Punkt.
Denn das führt dazu, dass ein Arzt auf Basis einer Diagnose Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen ausstellen kann, dass Therapien und Medikamente verschrieben werden können, dass gesellschaftliche Unterstützung in Anspruch genommen werden kann und das ist und das bleibt enorm wichtig!
Wenn wir da aber stehenbleiben, dann lösen wir nichts wirklich, sondern dann kleben wir immer nur ein Pflaster auf eine Wunde, die darunter aber weiter vor sich hin eitert und fault.
Es ist wichtig, dass wir Depressionen als Krankheit ansehen. Aber das alleine ist zu wenig.
Depressionen kommen nicht aus heiterem Himmel.
Sie entstehen, weil sich Prägungen aus unserer Kindheit plötzlich und unerwartet Bahn brechen.
Oder, weil wir uns in eine Situation manövriert haben, aus der wir keinen Ausweg mehr sehen.
Manchmal auch aus hormonellen Veränderungen oder einer generellen Schieflage des Austauschs von Botenstoffen in unserem Körper.
Meistens enstehen sie aber aus einem einzelnen Faktor heraus. Sondern aus einer Kombination von all dem.
Einer Kombination, die oft nicht auf den ersten Blick durchschaubar und schon gar nicht mit einem Schlag lösbar ist. Umso wichtiger ist es aber, auf diese Kombination zu schauen und sich nicht damit zufrieden zu geben, dass man von einer Krankheit befallen ist und „eben etwas anders tickt“.
Denn das tut nur eines: es liefert eine Entschuldigung.
Für das eigene Verhalten. Für einen selbst.
Vor allen Dingen aber für die Menschen, die einem diese Prägungen mitgegeben haben.
Die Gesellschaft. Die Partner. Und in den allermeisten Fällen die eigene Familie.
All diese Menschen aber sollte man in Verantwortung nehmen. Man sollte sie zum Nachdenken darüber bringen, welche Konsequenzen ihr Verhalten hatte und hat und wie man die leidvollen Konsequenzen dieses Verhaltens in Zukunft vermeiden oder zumindest lindern kann.
Ich habe den Missbrauch durch meine Mutter, die lieblose Erziehung und die bis heute andauernde Verleugnung meines Vaters, die Misshandlung durch meine Stiefmutter und die chaotischen und narzisstischen Verhältnisse in meiner unmittelbaren Umgebung aufgeschrieben und deutlich gemacht. Ich halte sie bis heute für die zentrale Ursache meiner Leiden. Und die Ursache dafür, dass ich auch anderen Menschen Leid zugefügt habe.
Indem ich selbst chaotische Verhältnisse gesucht und narzisstische und missbräuchliche Verhaltensweisen an den Tag gelegt habe.
Es tut weh, sich selbst einzugestehen, dass einem nahe stehenden Menschen so etwas angetan haben.
Es tut noch mehr weh, sich einzugestehen, dass man selbst so gehandelt hat.
Hinsehen ist schmerzhaft – darum sind einfache Erklärungen so attraktiv
Einfacher wäre es natürlich gewesen, wenn ich einfach hätte sagen können: „in meinem Kopf ist eben etwas falsch“.
Dann hätte man nicht über die Untaten meiner Familie reden müssen. Alles wäre im Dunkeln geblieben. Die teilweise unfassbaren und einfach unmöglichen Lügengeschichten meiner Familie hätten weiter Bestand gehabt und vermeintlich niemand hätte sich daran gestört.
So habe ich das bei vielen anderen „Depressions-Erkrankten“ gesehen.
Dort wurde nichts aufgearbeitet, der „Kranke“ war eben „krank“ und als Solcher hatte er dann eine akzeptierte Rolle in Familie und Gesellschaft. Er war eben „ein bisschen anders“, aber „das ist schon okay so“.
Dann hatten plötzlich auch die Umstehenden wieder eine Rolle: sie konnten sich um den Kranken kümmern.
Anstatt ihren eigenen Anteil am Entstehen dieser Situation zu hinterfragen.
Vielleicht war er dann irgendwann auch wieder halbwegs gesund.
Meistens hielten aber die Diskriminierungen, die toxischen Verhaltensweisen, die schiefen Verhältnisse auf jeden Fall weiter an. Mal offener und mal verdeckter.
Und das eigene Verhalten wurde eben nicht überprüft und einfach weiter durchgezogen, nur eben jetzt mit einer gesellschaftlich akzeptierten Entschuldigung für die eigenen Fehlbarkeiten und einer zusätzlichen Rolle als aufopferungsvoller Helfer dieses armen kranken Menschen.
Und irgendwann krachte dann halt wieder alles zusammen.
Ob bei den „Erkrankten“ selbst, im Konflikt mit ihren Partnern oder in der Beziehung zu ihren Kindern.
Es war meistens nur die Frage nach dem „wann“ und nicht nach dem „ob“. Und das wurde dann eben als „Remission der Krankheit“ bezeichnet. Oder es lieferte einen Beweis dafür, dass Depressionen erblich bedingt seien. Aber vor allen Dingen schien es einen Beweis dafür zu liefern: Depressionen sind eine unheilbare Krankheit, gegen die man nichts tun kann. Egal, wie sehr man sich kümmerte.
Obwohl man mit dieser Annahme meistens eigentlich nichts dafür getan hat, dass sich wirklich etwas ändert.
Man hat nichts an den Ursachen verändert. Man hat einfach nur eine Erklärung darauf geklebt.
Und dass sich nichts verändert, wenn man selbst nichts verändert, das sollte auf der Hand liegen.
Aber wenn etwas nicht heilbar ist, dann hat man selbst ja auch keinen Anlass, irgendetwas dafür oder dagegen zu tun. Dann „ist man eben so“. Und es ist gemeingefährlich attraktiv, sich dieser vermeintlichen Wahrheit einfach hinzugeben.
Verhalten und Konsequenz sind eine bessere Erklärung als Krankheit
Die viel logischere Erklärung wäre doch eher, dass schädliches Verhalten weitergegeben wird und zu neuem schädlichen Verhalten im Gegenüber führt, wenn man es nicht behandelt und ändert. Dass es Konsequenzen hat, wie wir mit Menschen umgehen. Kurz-, mittel- und eben auch langfristig.
Dass das, was wir tun und lassen, Folgen hat. Für uns selbst, aber auch für andere.
Das aber ist anstrengend.
Denn das würde ja bedeuten, dass man das eigene Verhalten und das Verhalten nahestehender Menschen einer Prüfung unterziehen müsste.
Und eine solche Prüfung kann weh tun.
Eine solche Prüfung kann Dinge zutage fördern, mit denen man sich auseinandersetzen muss.
Das ist anstrengend.
Entsprechend ist es viel bequemer, sich einem Krankheits-Narrativ anzuhängen als Ursachen oder anhaltende Verhaltensweisen zu analysieren.
Denn Letzteres bedeutet Arbeit. Bei sich und anderen.
Das ist unbequem.
Eine einfache Krankheit als Ursache entledigt einen aber von all dieser mühsamen Arbeit.
Damit tut sie am Ende aber etwas sehr Fatales: sie schützt Täter und erhält schädliches Verhalten.
Denn wenn man zu bequem ist oder Angst davor hat, Dinge anzuschauen und zur Sprache zu bringen, dann lässt man eben auch genau diese Dinge im Dunkeln.
Man lässt zu, dass es „immer zwei Seiten gibt“.
Nicht falsch verstehen: es gibt immer zwei (und meistens mehr) Seiten.
Wir sollten uns nur klar darüber werden, welche Konsequenzen was hat.
In meinen Augen brauchen wir dringend einen intelligenteren Umgang mit Depressionen als diesen.
Wir brauchen eine intensivere Auseinandersetzung mit den wirklichen Ursachen von Depressionen.
Einen Blick, der weiter geht als der bloße Krankheits-Blick. Eine Bereitschaft dafür, offen über die Entstehungsbedingungen und Ursachen von Depressionen zu sprechen – auch wenn das anderen und einem selbst weh tut, weil es unbequeme Wahrheiten zu tage fördert, die manche lieber tot schweigen würden.
Das bequeme Krankheitsmodell schützt Täter – und schadet denen, die den Finger in die Wunde legen
Das versuche ich. Ich versuche es, indem ich meine Geschichte öffentlich erzähle. Ich versuche es, indem ich das Rucksack-Modell * entwickelt habe und darüber einen greifbaren Ansatz liefere, auf dessen Basis eine solche Diskussion beginnen könnte. Und noch so vieles mehr.
Dafür bekomme ich aber:
- verschlossene Türen
- Absagen zur Zusammenarbeit von der Deutschen Depressionsliga und dem Bündnis gegen Depression
- keine Verlagszusammenarbeit für mein Buch
- eine überschaubare Zahl an Medienberichterstattung
- Ausgrenzung von meiner Familie und
- eine fortlaufende Frustration, wenn ich sehe, dass Menschen, die einfach nur von ihrer Krankheit erzählen, einen Freifahrtschein für gesellschaftlich eigentlich komplett inakzeptables Verhalten bekommen und all das an Unterstützung und Öffentlichkeit erhalten, was ich mir schon lange wünschen würde
Ich bin glücklicherweise inzwischen weit davon entfernt, in Suizid-Gedanken abzurutschen. Aber fortlaufend das Gefühl zu bekommen, mit einer fassbaren und logischen Erklärung zu scheitern und ausgegrenzt zu werden, während andere für diskriminierendes und respektloses Verhalten und eine viel zu einfache Erklärung anhaltenden Applaus bekommen – das nährt das Gefühl, nicht in diese Welt zu passen.
Ein Gefühl, das ich schon mein ganzes Leben lang kenne und das ich wahrscheinlich nie mehr los werde.
Das aber keine Krankheit im Kopf ist, sondern eine logisch nachvollziehbare Reaktion meines Geistes auf das, was man mir angetan hat.
Mit der ich leben könnte, wenn wir als Gesellschaft offen darüber sprechen würden und ich für diesen ewigen Kampf auch etwas Anerkennung bekommen würde.
Wenn ich das Gefühl hätte, dass mein Engagement auch etwas bewirkt.
Dass es dazu beiträgt, dass wir uns in eine Richtung entwickeln, in der wir unser Verhalten hinterfragen. Die Konsequenzen. Und die daraus entstehenden Folgen. Bis eben hin zu Depressionen.
Dann hätte ich das Gefühl, dass meine eigene Geschichte vielleicht sogar am Ende für etwas gut war.
Dass ich durch meine Aufarbeit dabei helfe, dieses Leiden künftig zu verringern.
Wenn ich aber erlebe, dass mich die eigene Aufarbeitung und die damit verbundene Klarheit ausgrenzt und eben eher die Applaus bekommen, die irgendwas von einer Krankheit erzählen, aber nichts wirklich an sich, ihren toxischen Beziehungen oder ihrem eigenen Verhalten ändern, dann tut das einfach nur weh.
Denn dann habe ich das Gefühl, dass wir einfach so weiter machen. Dass wir uns in einer Opfer-Rolle halten.
Und damit immer weiter die nächsten Opfer produzieren.
Ich wünsche mir, dass ich noch erleben darf, dass wir das besser hinbekommen.
—
* Das Rucksack-Modell ist ein Erklärungsansatz, den ich entwickelt habe, um zu zeigen, dass Depressionen und psychische Krisen selten aus dem Nichts entstehen. Es beschreibt, wie vier Faktoren – biologische Voraussetzungen, frühkindliche Prägungen, die aktuelle Lebenssituation und unser soziales Umfeld – zusammenwirken und unser seelisches Gleichgewicht beeinflussen.
Es ist dabei kein Ersatz für medizinische Hilfe, sondern ein Werkzeug, um die wahren Hintergründe zu verstehen, Verantwortung klar zu benennen und damit auch Veränderungspotenziale und Handlungsoptionen zu erkennen.