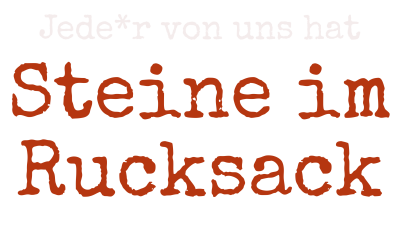Hilfe & Orientierung
Diese Seite soll Orientierung und Wegweiser sein für Menschen, die sich um Hilfe bemühen möchten.
Sie ist so gestaltet, dass sie sich leicht von oben nach unten lesen lässt.
Falls Du aber mehr Interesse an einem spezifischen Bereich hast, kannst Du Dich auch mit den Kacheln rechts direkt dort hin führen lassen.
Wenn Du aber sofort Hilfe brauchst und dringend mit jemandem sprechen willst, dann klick bitte direkt auf den roten Knopf:
Arten von Therapie
Wie unterschieden sich Therapien voneinander und wieso ist das wichtig?
Wichtige Begriffe
Welche Begriffe und Unterschiede sollte man unbedingt mal gehört haben?
Eine gute Therapie
Zeit, Dauer und Wirkung – eine gute Therapie erkennt man an diesen Kriterien
...und so viel mehr
Was man neben und zusätzlich zu Therapie noch tun kann (eine ganze Menge)
Du bist auf einem Weg...
…der Dich hierher geführt hat. Und alleine das ist schon viel wert. Denn es zeigt, dass Du Dich um Dich selbst kümmerst.
Diese Seite soll Dir zeigen, dass Du nicht allein bist und auch nicht allein gelassen wirst. Es gibt sehr viel mehr Hilfsangebote als auf den ersten Blick zu sehen sind.
Wir möchten Dir Mut machen. Dir Optionen zeigen, wie Du Deinen Weg gestalten kannst. Erzählen, wie andere ihren Weg gegangen sind.
Es gibt aber leider auch sehr viele demotivierende Botschaften da draußen. Rechts findest Du ein paar davon. Klick einfach mal drauf.
Du kannst aber auch direkt mal schauen, wo Deine Steine liegen und den Test machen, den wir dafür vorbereitet haben:
...auf dem ein paar Steine liegen
Auf eine Therapie muss ich ewig warten
So pauschal stimmt das nicht. Dazu gleich mehr.
Mit Therapie-Plätzen ist es dasselbe wie mit allem: es gibt nur eine begrenzte Zahl. Und wo immer es begrenzte Kapazität gibt, muss priorisiert werden.
Um priorisieren zu können, müssen Therapeuten eine erste Untersuchung mit Dir machen. Abklären, ob Deine Probleme wie eine offene, blutende Wunde sind, die lebensgefährlich ist, wenn sie nicht sofort behandelt wird. Und wenn das so ist, dann gibt es dafür Akut-Plätze. Auf die Du dann auch aufmerksam gemacht wirst.
Oder ob Deine Probleme wie eine schiefe Bandscheibe sind: unangenehm und manchmal wirklich schmerzhaft, aber nicht lebensbedrohlich. Dann wird die Behandlung zugunsten der Notfälle und derer, die vor Dir in der Schlange stehen, erstmal aufgeschoben.
Entsprechend ist wichtig:
_ in die Schlange zu kommen (die längste Wartezeit geht irgendwann vorbei – aber dafür muss sie auch erstmal anfangen)
_ die Zeit zu nutzen, um Dir selbst über Therapie-Ziele, Therapie-Art und den richtigen Therapeuten klar zu werden
_ Dir klar zu machen, dass Therapie ein Baustein ist, um Deine Themen zu bearbeiten, aber nie die Allheil-Lösung, auf die man alle Hoffnung bauen sollte
Darum: wenn Du Dir klar bist, dass Du eine Therapie beginnen möchtest, dann komm ins Gespräch mit Therapeuten. Das ist oft leichter als Du denkst (siehe auch der nächste Punkt).
Termine beim Therapeuten gibt es eh nicht
Es stimmt: Die Versorgungslage ist angespannt, und Wartezeiten gehören leider vielerorts dazu. Daraus aber zu schließen, dass es gar keine Termine gibt, stimmt nicht – und bringt einen auch nicht weiter.
In Deutschland ist gesetzlich geregelt, dass jeder kassenzugelassene Psychotherapeut Zeit für neue Patienten freihalten muss:
100 Minuten pro Woche sind für Erstgespräche reserviert.
200 Minuten pro Woche müssen Therapeuten telefonisch erreichbar sein. Die Zeiten müssen festgelegt, auf Band angesagt und bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) hinterlegt werden.
Praktisch läuft es also so: Außerhalb der Erreichbarkeitszeiten anrufen, die Bandansage mit den Telefonzeiten anhören und notieren, zu diesen Zeiten erneut anrufen – in diesen Fenstern ist die Praxis telefonisch besetzt und es können Termine für eine erste Sprechstunde vergeben werden.
Zusätzlich unterstützt die Terminservicestelle der KV unter 116 117. Sie muss innerhalb von vier Wochen einen Termin für eine psychotherapeutische Sprechstunde vermitteln. Ist das nicht möglich, kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Anspruch auf Kostenübernahme bei einem privaten Therapeuten entstehen.
Frust ist nachvollziehbar. Aber er sollte nicht zur Ausrede werden, gar nichts zu unternehmen. Wer seine Rechte kennt und die vorhandenen Wege nutzt, erhöht die Chancen, Unterstützung zu bekommen.
Therapie hilft mir nicht
Mit einem Hammer kann man keine Schraube eindrehen. Und mit einem Schraubendreher keinen Nagel einschlagen. Trotzdem würde niemand sagen, dass Werkzeuge sinnlos sind.
Genauso ist es mit Therapie: Wichtig ist, sich klarzumachen, welche Therapie für welchen Zweck geeignet ist – und wer der passende Therapeut dafür ist.
Oft weiß man das am Anfang gar nicht, weil die eigenen Probleme überwältigend und diffus wirken. Auch dann kann Therapie helfen, Ordnung zu schaffen. Der Anspruch sollte aber nicht sein, dass sofort alles gelöst wird.
Therapie ist ein Werkzeug. Man sollte bewusst prüfen, wie man es nutzt – und immer wieder reflektieren, ob es noch das richtige Werkzeug ist.
Schlechte Erfahrungen dürfen nicht dazu führen, Therapie pauschal zu verteufeln. Das deutsche System mit Sprechstunden, Probatorik und anschließender Auswahl bietet die Chance, verschiedene Ansätze und Methoden kennenzulernen. Diese Vielfalt sollte, kann und darf man nutzen.
Ohne einen Therapie-Platz wird das nie was
Eine Therapie ist kein Allheilmittel – und auch ihr Ausbleiben heißt nicht, dass es nie besser werden wird.
Gerade wenn man viele Steine mit sich herumträgt, ist die Gefahr groß, einen Therapie-Platz als einzigen Ausweg zu sehen. Und sich enttäuscht oder entmutigt zu fühlen, wenn man den nicht bekommt oder lange darauf warten muss.
Wichtig dabei ist aber: ein Therapieplatz alleine löst nichts. Genausowenig wie ein neuer Partner, ein Haustier, ein Kind oder ein Lottogewinn.
Echte Lösungen und echte Heilung kommen nie von nur einer Sache. Sie entstehen immer aus einer Kombination verschiedener Faktoren – und beginnen meist tief in uns selbst. Therapie kann dafür ein wichtiger Baustein sein. Sie hilft, Dinge zu verstehen und zu bearbeiten. Aber sie entbindet uns nicht davon, selbst Verantwortung zu übernehmen und unseren eigenen Weg zu gehen.
Ein fehlender Therapieplatz heißt entsprechend nicht, dass man zum Scheitern verurteilt ist. Und er ist auch keine Entschuldigung dafür, den eigenen Weg nicht weiter zu gehen. Es ist erstmal nur ein Baustein weniger. Aber es gibt auch andere, die trotzdem genutzt werden können. Als Überbrückung, als Ersatz, als Steine, mit denen man den eigenen Weg sinnvoll gestaltet.
Mir geht's nur gut, so lange ich Therapie habe
Therapie ist dafür da, Veränderungen anzustoßen: Muster erkennen, Erlebtes einordnen, Werkzeuge für den Alltag entwickeln. Sie soll helfen, das Leben auch ohne therapeutische Begleitung besser zu meistern.
Eine dauerhafte Gewöhnung an Therapie ist weder individuell noch gesellschaftlich sinnvoll. Für Begleitung im Alltag sind Freunde, Selbsthilfegruppen oder passende Organisationen besser geeignet – vielleicht künftig auch KI.
Natürlich gibt es Erkrankungen, bei denen längerfristige oder wiederkehrende Therapie notwendig ist. Doch das Ziel bleibt: Selbstständigkeit fördern statt Therapie zum Dauerzustand werden zu lassen.
Anderen geht es doch viel schlechter als mir
Diesen Gedanken haben viele. Aber psychische Belastungen lassen sich nicht im Wettbewerb messen. Ob deine Steine klein oder groß wirken, spielt keine Rolle – entscheidend ist, wie schwer sie sich für dich anfühlen.
Es macht keinen Sinn, das eigene Leid kleinzureden. Nur weil andere vielleicht anderes oder Härteres erlebt haben, heißt das nicht, dass deine Themen weniger wichtig sind.
Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist keine Frage von „Schwere im Vergleich zu anderen“, sondern von eigener Belastung. Wenn es dich einschränkt, wenn es dir den Alltag schwer macht oder dich innerlich blockiert, dann ist das Grund genug, etwas zu verändern.
Schau dir dazu auch unseren Rucksack-Test an. Dort bekommst du eine erste Einschätzung, wo du stehst, was du angehen kannst – und kannst das Ergebnis direkt zu einem Ansprechpartner (Hausarzt, Therapeut, Krisenberatung) mitnehmen, um gemeinsam über die nächsten Schritte zu sprechen.
Es gibt soviele falsche Annahmen - hier sind noch mehr...
Vom Gedanken, dass Therapie immer ein Allheil-Mittel ist, was alle Probleme löst bis hin zur Befürchtung, dass jeder, der in Behandlung geht, einfach nur mit Medikamenten vollgestopft wird, haben wir hier nochmal eine ganze Menge falscher Annahmen und Mythen gesammelt.
Arten von Therapie
Genau so wie man mit einem Auto, Motorrad oder Hubschrauber von A nach B kommen kann, gibt es auch bei Psychotherapien verschiedene Wege zum Ziel. Im Folgenden werden die wichtigsten Therapie-Arten aufgeführt, um Dir einen Überblick darüber zu geben, was es gibt und was das Ziel des jeweiligen Weges ist. Du solltest Dir darüber bewusst sein, welche Art von Therapie Du anstrebst. Dann kannst Du nämlich auch gezielt nach einem Therapeuten suchen, der genau das anbietet und im Erstgespräch direkt über mögliche Ziele und Wege sprechen.
Die Verhaltenstherapie fokussiert stark auf das gegenwärtige Verhalten. Sie versucht durch Methoden der Alltagsstrukturierung, Veränderungen von Gewohnheiten und Glaubenssätzen und deren Einübung durch Wiederholung das aktuelle Erleben zu verbessern.
Teilweise wird auch in der Verhaltenstherapie analytisch in der Biographie nach Ursachen für die heutigen Konflikte gesucht. Vornehmlich liegt der Fokus aber auf einer erfolgreicheren Bewältigung des Alltags und einer Verbesserung des gegenwärtigen Erlebens und Verhaltens.
Die Verhaltenstherapie eignet sich daher vor allem dann, wenn der eigene Alltag nur schwer zu bewältigen ist und zunächst eine erste Ordnung hergestellt werden soll. Sie erzielt schnelle Erfolge, zeigt aber Schwächen in der Nachhaltigkeit ihrer Ergebnisse (Resilienz) und führt zu höheren Rückfallraten als tiefenpsychologische oder analytische Therapien.
Die Tiefenpsychologie geht davon aus, dass die heutige Erkrankung ihre Ursache in einem erlebten und nicht verarbeiteten Konflikt in der früheren Biographie des Patienten hat. Sie versucht, diesen Konflikt aufzudecken und durch verschiedene Methoden dazu beizutragen, dass der Patient den Konflikt für sich auflösen kann.
Hierbei können auch begleitende Therapien wie Traumatherapie, Körpertherapie, o.ä., hilfreich sein. Da für die Aufarbeitung des Konfliktes Erinnerungsleistungen an möglicherweise erlebte Traumata notwendig sind, besteht bei der Tiefenpsychologie immer die Gefahr einer zeitweiligen Symptomverschlimmerung. Hierauf wird der Therapeut im Fortlauf der Therapie besondere Rücksicht nehmen und den Grad der Belastung mit seinem Patienten absprechen.
Die Dauer einer tiefenpsychologischen Therapie ist somit entsprechend von der Belastbarkeit und Stabilität des Patienten und von der Tiefe des erlebten Traumas abhängig.
Die Psychoanalyse bzw. analytische Psychotherapie geht meist von einer Kombination verschiedener Traumata aus, deren Bearbeitung nicht isoliert möglich ist. Darum wird durch ein spezifisches Methoden-Set daran gearbeitet, die Ursachen der stabilen Ansichten und Verhaltensweisen in Frage zu stellen und hierdurch aufzulösen. Hierfür ist beim Patienten ein erhöhtes Reflektionsvermögen notwendig.
Zudem besteht bei der analytischen Psychotherapie insbesondere zu Beginn ein großes Risiko für zeitweilige und teilweise auch länger andauernde Symptomverschlimmerungen, da komplette traumatische Lebensabschnitte rückerinnert und Grundüberzeugungen in Frage gestellt werden. Für die Psychoanalyse ist ein außerordentlich vertrauensvolles Verhältnis zwischen Patient und Therapeuten notwendig, das erst im Laufe der Therapie entstehen kann.
Die analytische Psychotherapie gilt hinsichtlich der Resilienz als wirksamste Therapie, ist aber auch die langwierigste und anstrengendste der drei Therapieformen.
Die systemische Therapie ist die jüngste, kassenzugelassene, Psychotherapiemethode. Sie fokussiert vor allem auf das soziale System des Patienten und in diesem Zusammenhang häufig auf den Familienkontext.
Durch diese Herangehensweise lässt sich gerade bei krisen- , aber nicht krankhaften, Lebensverläufen eine kürzere Therapie-Dauer realisieren als bei den bisherigen schulmedizinischen Verfahren.
Kassenzugelassene und approbierte Psychotherapeuten dürfen die systemische Therapie als Kassenleistung mit anbieten.
Darüber hinaus gibt es auch systemische Berater. Diese Berater verfügen nicht über eine Kassenzulassung und die Berufsbezeichnung ist auch nicht geschützt. Üblicherweise lassen sich systemische Berater aber von der Systemischen Gesellschaft oder der DGSF zertifizieren.
Die Körpertherapie (eigentlich: körperorientierte Psychotherapie) gehört streng genommen zur Schule der Tiefenpsychologie und geht davon aus, dass der Körper unbewusst und rational schwer zugänglich Erinnerungen abspeichert. Dabei werden Körperhaltung und -wahrnehmung dazu genutzt, unbewusste, psychische Prozesse aufzudecken.
Die Körpertherapie eignet sich vor allen Dingen für Patienten, die Schwierigkeiten damit haben, ihre Situation zu verbalisieren und in einem therapeutischen Kontext darüber zu sprechen, da bei dieser Form der Therapie viel über körperliche Muster und wenig über die sprachliche Auseinandersetzung und Erzählung gearbeitet wird.
Coaches können bei krisenhaften Lebenverläufen oder wesentlichen Veränderungen im (Berufs-)Leben häufig mit erprobten Methoden weiterhelfen, die alltägliche Störungen beheben oder tiefere Ursachen sichtbar machen.
Der Begriff „Coach“ ist nicht geschützt und kann daher von jedem Menschen geführt werden – ganz gleich, welche Ausbildung dahinter steckt. Gute Coaches absolvieren Weiterbildungen und zeichnen sich entsprechend durch Zertifikate aus, die sie einfach erfragen oder auf der Website einsehen können.
Coaches können hilfreich sein. Es sollte aber immer bedacht werden, dass bei tieferliegenden und größeren Problemen auch das Risiko einer Verschlimmerung der Erkrankung bestehen kann, da Coaches oft die übergreifende Ausbildung zum Umgang mit psychischen Erkrankungen fehlt und somit manchmal unbewusst Methoden angewandt werden, die einen gegenteiligen Effekt erzielen.
Gute Coaches wissen, wo sie helfen können. Sie wissen aber noch viel mehr, wo ihre Grenzen liegen.
Wer hat welche Rolle?
Hausarzt
Hat eine ganz zentrale Rolle. Aber welche eigentlich und warum?
Dein Hausarzt kennt deine gesamte gesundheitliche Situation und sollte über alles Wichtige informiert sein. Er sorgt für den Überblick: von körperlicher Verfassung über Krankschreibungen bis zu Überweisungen. Er sollte für seelische und medizinische Probleme immer die erste Anlaufstelle sein.
Therapeut
Hilft dir, Muster zu verstehen und neue Strategien zu entwickeln.
Mit einem Therapeuten gehst du an deine Themen heran, erkennst Zusammenhänge und entwickelst Wege, besser damit umzugehen. Entscheidend ist Vertrauen – auch, wenn es mal Risse bekommt, sollte das besprechbar sein.
Psychiater
Spezialist / Facharzt für die medizinische Behandlung der Psyche.
Psychiater können Dich zu Medikamenten beraten und sie verschreiben. Sie kennen sich mit Wirkung und Nebenwirkung psychopharmakologischer Mittel am besten aus. Damit ergänzen sie oft die Arbeit von Hausarzt und Therapeut.
Klinik
Notfallhilfe und Stabilisierung, wenn es allein nicht mehr geht.
Bei akuten Krisen, etwa schweren Depressionen oder Panikattacken, kann ein Klinikaufenthalt notwendig sein. Er dient üblicherweise der Stabilisierung, kann aber auch als Startpunkt für ein tiefere Behandlung sinnvoll sein.
Ämter und Behörden
Sorgen für finanzielle Absicherung und rechtliche Ansprüche.
Bei längerer Erkrankung sichern Leistungen wie Krankengeld oder ein anerkannter Grad der Behinderung ab. Du solletst Dich früh und umfassend über Deine Ansprüche informieren – auch wenn der Kontakt zu Ämtern oft anstrengend ist.
Soziale Träger
Unterstützen praktisch – vom Behördengang bis zur Selbsthilfe.
Einrichtungen wie Diakonie, AWO oder andere Träger bieten Unterstützung: z. B. bei Alltagsfragen, beim Finden von Selbsthilfegruppen oder im Umgang mit Behörden. Ein Blick auf lokale Angebote lohnt sich.
Arbeitgeber
Was sage ich? Bekomme ich Hilfe oder riskiere ich meinen Job?
Du musst keine Diagnose offenlegen. „Ich bin krank und komme zurück, wenn ich gesund bin“ reicht. Sei dir aber bewusst: Bei längerer Krankheit ist eine Kündigung möglich – hier kann rechtliche Beratung helfen.
Anwalt
Kennt deine Rechte und hilft, sie durchzusetzen.
Ob gegenüber Arbeitgebern, Behörden oder Krankenkassen – ein Anwalt oder Sozialverband kann dich unterstützen, damit du nicht aus Unsicherheit oder Angst vorschnell auf Ansprüche verzichtest.
Selbsthilfegruppe
Geben Rückhalt, Austausch und ein Gefühl von „nicht allein“.
In Selbsthilfegruppen triffst du Menschen mit ähnlichen Erfahrungen. Das kann Halt geben und das Gefühl vermitteln, mit den eigenen Sorgen und Nöten nicht alleine zu sein.
Was macht eigentlich ein...
Psychologe
Ein Psychologe hat ein Studium der Psychologie abgeschlossen und kennt sich mit Denken, Fühlen und Verhalten von Menschen aus. Ohne eine zusätzliche Ausbildung darf ein Psychologe jedoch keine Psychotherapie im medizinischen Sinn durchführen.
Psychotherapeut
Ein Psychotherapeut ist ein Überbegriff für alle Fachleute, die psychische Erkrankungen mit anerkannten Verfahren behandeln – dazu gehören psychologische und ärztliche Psychotherapeuten. Ob ein Psychotherapeut Medikamente verschreiben darf, hängt vom Grundberuf ab.
Psychologischer Psychotherapeut
Ein psychologischer Psychotherapeut hat Psychologie studiert und anschließend eine mehrjährige staatlich anerkannte Zusatzausbildung in Psychotherapie absolviert. Ein psychologischer Psychotherapeut arbeitet mit wissenschaftlich geprüften Methoden wie Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie oder Psychoanalyse, darf aber keine Medikamente verschreiben.
Ärztlicher Psychotherapeut
Ein ärztlicher Psychotherapeut ist ein Arzt, der zusätzlich eine Facharztausbildung in Psychiatrie und Psychotherapie oder in Psychosomatischer Medizin gemacht hat. Ein ärztlicher Psychotherapeut behandelt psychische Erkrankungen mit psychotherapeutischen Methoden und darf zusätzlich Medikamente verschreiben sowie körperliche Ursachen abklären.
Heilpraktiker Psychotherapie
Ein Heilpraktiker für Psychotherapie hat keine reguläre psychologische oder medizinische Ausbildung. Ein Heilpraktiker erhält seine Zulassung über eine staatliche Prüfung beim Gesundheitsamt, wobei die Qualität und die angewandten Methoden stark variieren können.
Psychiater
Ein Psychiater ist ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Ein Psychiater ist spezialisiert auf die medizinische Behandlung psychischer Erkrankungen, insbesondere mit Medikamenten, bietet aber häufig auch Gespräche oder begleitende Psychotherapie an.
Life / Business Coach
Ein Life- oder Business-Coach ist kein geschützter Beruf – jeder darf sich so nennen. Ein Coach kann Menschen bei Fragen zu Beruf, Alltag oder persönlicher Entwicklung unterstützen, ist aber kein Therapeut und hat keine staatlich geregelte Ausbildung.
Weitere Begriffe
Supervision
Alle Psychotherapeuten müssen sich einer regelmäßigen Supervision unterziehen. Das bedeutet, dass sie selbst regelmäßig mit einem Psychotherapeuten sprechen, um die Dinge, die sie in der Therapie von ihren Patienten erfahren, so zu verarbeiten, dass es sie in ihrem eigenen Leben nicht beeinträchtigt. Zudem wird durch die Supervision sichergestellt, dass Therapeuten ihre eigenen Lebensthemen nicht in ihre Therapien mit einbringen und damit auf ihre Patienten übertragen.
Übertragung
Gerade bei längerfristig angelegten Therapien kann es zur Übertragung von Gefühlen vom Therapeuten auf den Patienten kommen und umgekehrt. Der Patient erkennt im Therapeuten seinen Retter und überträgt positive Gefühle auf ihn – bis hin zum Verliebtsein.
Umgekehrt können Therapeuten ihre ungelösten Lebensprobleme auf Patienten projizieren und versuchen, ihre Probleme im übertragenen Sinn durch den Patienten zu lösen.
Bei Therapeuten verhindert eine gute Supervision eine solche Übertragung. Bei der Beziehung Patient-Therapeut müssen beide einen ehrlichen Umgang miteinander pflegen und über solche entstehenden Gefühle sprechen, um Übertragungen zu verhindern.
Abstinenzregel
Die Abstinenzregel bedeutet, dass Therapeuten keine privaten oder sexuellen Beziehungen zu Patienten eingehen dürfen. Sie dient dazu, die professionelle Grenze zu wahren und die Patientensicherheit zu schützen, insbesondere da sich durch Übertragung romantische Gefühle seitens der Patienten entwickeln können.
Akutbehandlung
Eine Akutbehandlung ist eine kurzfristig verfügbare psychotherapeutische Unterstützung in Krisensituationen. Sie soll schnelle Entlastung bringen und kann später in eine reguläre Therapie übergehen.
Kostenerstattungsverfahren
Das Kostenerstattungsverfahren greift, wenn kein Therapieplatz bei einem Kassentherapeuten verfügbar ist. In diesem Fall kann die Krankenkasse unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten für einen privaten Therapeuten übernehmen.
Schweigepflicht
Therapeuten und Ärzte unterliegen der Schweigepflicht. Alles, was du erzählst, bleibt vertraulich – außer es besteht eine akute Gefahr für dich oder andere.
(Psychiatrische) Klinik
Eine psychiatrische Klinik bietet stationäre Hilfe, wenn eine Krise zu schwer ist, um sie ambulant zu bewältigen. Dort gibt es medizinische und psychotherapeutische Behandlung sowie Unterstützung, um wieder Stabilität zu finden.
Neben psychiatrischen Kliniken gibt es auch psychosomatische bzw. psychoanalytisch orientierte Kliniken, die weniger auf Akutversorgung, dafür stärker auf das Aufdecken und Bearbeiten verborgener Muster ausgerichtet sind.
Was macht eine gute Therapie aus?
Therapie ist kein Selbstzweck – sie sollte immer einen Nutzen bringen. Hier sind ein paar Qualitätskriterien, mit denen abgeprüft werden kann, ob die eigene Therapie zielführend ist und was man ggf. tun kann, um den Prozess bewusst zu steuern.
"Gute Therapie ist kein Ziel – sie ist der Weg, auf dem du lernst, selbst zu gehen."
ChatGPT, frei nach Konfuzius
Eine gute Therapie braucht eine Richtung. So wie man in der Physiotherapie nicht erwartet, ewig behandelt zu werden, sondern wieder selbst laufen zu lernen, sollte auch Psychotherapie ein Ziel verfolgen.
Dieses Ziel kann sein, alte Muster zu verstehen, neue Strategien für aktuelle Belastungen zu entwickeln oder den eigenen Umgang mit schwierigen Gefühlen zu verbessern.
Wichtig ist, dass das Ziel nicht nur vom Therapeuten kommt, sondern gemeinsam entwickelt wird – und sich auch verändern darf, wenn du im Prozess neue Dinge erkennst.
Wenn du das Gefühl hast, dass deine Therapie sich im Kreis dreht oder du gar nicht weißt, worauf ihr hinarbeitet, ist das kein Vorwurf – sondern ein Moment, um nachzufragen:
„Was wollen wir mit der Therapie gerade eigentlich erreichen?“
Therapie soll helfen, nicht halten. Sie darf also so lange dauern, wie sie etwas bewegt – aber nicht endlos weiterlaufen, nur weil man sich daran gewöhnt hat.
Die Krankenkassen geben dafür klare Richtwerte:
Verhaltenstherapie: bis zu 60 Sitzungen
Tiefenpsychologisch fundierte Therapie: bis zu 100 Sitzungen
Analytische Psychotherapie: bis zu 300 Sitzungen
Diese Grenzen sind kein Schikane-Instrument, sondern sollen sicherstellen, dass Therapie zielgerichtet bleibt. Denn das eigentliche Ziel ist, langfristig wieder eigenständig mit den Herausforderungen des Lebens umgehen zu können.
Eine überlange Therapie hilft weder dir noch anderen: Sie verhindert oft, dass sich echte Selbstwirksamkeit entwickelt – und blockiert gleichzeitig Plätze für Menschen, die noch auf den Einstieg warten.
Eine gute Therapie merkt man daran, dass sich etwas bewegt. Vielleicht nicht sofort, aber nach einiger Zeit spürst du, dass du Situationen anders bewertest, Gefühle bewusster wahrnimmst oder dich selbst besser verstehst.
„Besser“ bedeutet dabei nicht „immer glücklich“, sondern: Du erkennst Muster, reagierst reflektierter, kannst Krisen früher abfangen oder Gespräche offener führen.
Das sind kleine, aber entscheidende Zeichen von Veränderung.
Wenn Therapie dagegen nur dafür sorgt, dass alles „irgendwie erträglicher“ bleibt, ohne dass sich etwas entwickelt, wird sie schnell zur Gewohnheit – wie ein Medikament, das Symptome lindert, aber nicht heilt.
Gute Therapie ist spürbar. Nicht weil sie perfekt ist, sondern weil du dich selbst darin wiederentdeckst – klarer, bewusster, handlungsfähiger und vor allem: eigenständiger.
Was gibt es außer Therapie?
Manchmal fühlen sich Menschen in psychischen Krisen verloren – besonders dann, wenn sie lange auf einen Therapieplatz warten müssen oder glauben, dass nur Therapie helfen kann.
Dabei geraten viele andere helfende Hände schnell aus dem Blick.
Wir haben hier einige Wege zusammengestellt, die in solchen Situationen unterstützen können – und verlinken zusätzlich auf Angebote anderer Träger, bei denen man weitere Informationen und Hilfe findet.
Es gibt viele Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen. Uns ist wichtig, Orientierung zu geben und zu zeigen, wo man überall Anschluss finden kann.
Und noch etwas ist uns wichtig: Du sollst wissen, dass es diese Wege und Angebote gibt. Wenn du die Kraft hast, sie zu nutzen – dann tu es. Wenn du sie heute nicht hast, ist das genauso in Ordnung. Manchmal darf man auch einfach durchhängen.
Nur eines: Tu bitte nichts, was dir die Chance auf ein Morgen nimmt.
Direkte Gesprächsangebote:
Telefonseelsorge / Chat
Die Telefonseelsorge bietet immer ein offenes Ohr für akute Probleme. Ruf einfach an:
Und wenn Du nicht telefonieren möchtest, kannst Du Dir hier auch per Chat in Kontakt treten.
Redezeit / Wir hören Dir zu
Manchmal ist es einfach wichtig, jemanden zum Reden zu haben und das muss nicht immer ein Therapeut sein.
Dafür gibt es das Angebot „Redezeit für Dich“ von der Fürstenberg Foundation.
Dort kannst Du mit Menschen in Kontakt treten, die ein offenes Ohr für Dich haben. Hier geht’s zur Seite von REDEZEIT.
Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz kann in psychischen Krisen eine wertvolle Unterstützung sein. Sie hilft, Gedanken zu ordnen, Gefühle in Worte zu fassen, Informationen zu finden oder den nächsten Schritt auf dem Weg zu professioneller Hilfe vorzubereiten. Besonders in Zeiten, in denen kein Therapeut verfügbar ist, kann KI eine wichtige Brücke sein – ein Ort, an dem man sich sortieren, reflektieren und ein Stück Orientierung gewinnen kann.
Wie hilfreich sie ist, hängt stark davon ab, wie bewusst man sie nutzt. KI kann Denkanstöße geben und neue Perspektiven eröffnen – sie kann aber auch vorhandene Muster verstärken, wenn man unreflektiert mit ihr arbeitet und nur bestätigt, was man ohnehin schon denkt.
Ein erster Schritt kann sein, unseren Selbst-Test auf dieser Webseite zu nutzen. Die Ergebnisse lassen sich mit einem Klick in die Zwischenablage kopieren und anschließend bei ChatGPT oder einer anderen KI einfügen.
Ebenfalls hilfreich:
Selbsthilfegruppen
Der Austausch mit anderen Betroffenen kann oft schon eine große Hilfe sein, um selbst besser mit der eigenen Situation klar zu kommen.
In der Datenbank der NAKOS kannst Du schauen, welche Selbsthilfegruppen es in Deiner Nähe gibt und ggf. auch nach digitalen Selbsthilfegruppen Ausschau halten.
Dort gibt es auch spezialisierte Angebote für junge Menschen.
Genesungsbegleiter (EX-IN)
Der Verein EX-IN bildet u.a. Genesungsbegleiter*innen aus, die Betroffenen zur Seite stehen.
Bündnis gegen Depression
Das Bündnis gegen Depression von der Deutschen Depressionshilfe ist ein Zusammenschluss von über 90 regionalen Angeboten, die Menschen mit Depressionen Hilfestellung anbieten.
Auf der Hauptseite findest Du jede Menge weitere Hilfsangebote, u.a. eine Telefonnummer, an die Du Dich wenden kannst.
Und auf dieser Unterseite findest Du weitere Informationen zu Deiner jeweiligen Region.
Deutsche Depressionsliga
Die deutsche Depressionsliga versteht sich als bundesweit aktive Patientenvertretung von Menschen, die an Depression erkrankt sind.
Auch wenn wir selbst leider keine guten Erfahrungen mit der Depressionsliga gemacht haben und vieles an deren Arbeit kritisch sehen, sind wir überzeugt davon: was hilft, hat Recht.
Schau Dich also gerne bei der Depressionsliga um, ob es dort vielleicht etwas gibt, das Dir ganz persönlich weiterhelfen kann.
Hier geht’s zur Webseite der Depressionsliga.
Falsche Annahmen
Hier findest du einige Gedanken, die vielen Menschen in psychischen Krisen durch den Kopf gehen. Klick einfach auf einen davon, um zu lesen, wie wir ihn einordnen – und welche Perspektive vielleicht hilfreicher sein könnte.
So bin ich halt – das kann man nicht ändern.
Viele verwechseln Charakter mit Mustern oder gelernten Reaktionen. Veränderung ist mühsam, aber möglich.
Mit Medikamenten wird sowieso alles unterdrückt.
Antidepressiva oder andere Psychopharmaka sind keine Betäubung, sondern können Symptome lindern und die Arbeit an den Ursachen erst ermöglichen.
Mir geht’s doch noch nicht schlecht genug für Therapie.
Therapie ist nicht nur für „den völligen Zusammenbruch“, sondern auch für frühe Phasen und Vorbeugung gedacht.
Einmal Therapie – und dann ist alles gut.
Therapie ist kein „Reset-Knopf“. Sie vermittelt Werkzeuge, die dauerhaft geübt und angewendet werden müssen.
Andere haben viel schlimmere Probleme als ich.
Vergleich macht hilflos. Ob Hilfe nötig ist, entscheidet nicht die Größe im Vergleich zu anderen, sondern die eigene Belastung.
Wenn ich stark genug wäre, müsste ich das alleine schaffen.
Stärke zeigt sich nicht darin, alles allein durchzustehen, sondern auch Hilfe annehmen zu können.
Nach so vielen Rückschlägen bringt es doch eh nichts mehr.
Gerade mehrere Anläufe gehören oft zum Prozess. Jeder Versuch kann neue Erkenntnisse bringen.
Therapeuten sagen eh immer nur das Gleiche.
Es gibt verschiedene Ansätze (kognitive Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch, analytisch usw.). Unterschiede sind spürbar – und es lohnt sich, nach einem passenden Gegenüber zu suchen.
Wenn die Kasse nicht zahlt, dann geht es wohl nicht.
Es gibt das Kostenerstattungsverfahren und andere Wege, Therapie zu finanzieren. Die Kassenärztliche Vereinigung (116 117) kann dabei helfen, passende Lösungen zu finden.
Ich hab schon so viel probiert – ich bin wohl einfach hoffnungslos.
Oft braucht es Zeit, mehrere Versuche oder einen anderen Ansatz. Vielleicht findest Du auf dieser Seite ja noch etwas Inspiration.
Ich will keine Schwäche zeigen – das würde niemand verstehen.
Offenheit ist keine Schwäche, sondern ein Ausdruck von Mut. Wer über das spricht, was ihn belastet, übernimmt Verantwortung – für sich und sein Leben.
Ich will niemandem zur Last fallen.
Hilfe anzunehmen bedeutet nicht, anderen etwas wegzunehmen. Es gibt Menschen und Stellen, die genau dafür da sind – und die froh sind, wenn du dich meldest.
Soforthilfe im Notfall
Wenn du dich in einer akuten Krise befindest oder daran denkst, dir etwas anzutun:
Bitte bleib nicht allein. Hilfe ist IMMER und AUCH JETZT erreichbar – sofort und kostenlos.
116 117
Bereitschaftsdienst
Rund um die Uhr erreichbar. Dort bekommst du medizinische Hilfe oder wirst an den nächsten Krisendienst weitervermittelt.
👉 Du erreichst dort echte Menschen, die geschult sind, ruhig zuzuhören und dich an die richtige Stelle weiterzuleiten.
112
Notruf
Bei akuter Gefahr für dich oder andere – ruf sofort den Rettungsdienst an oder geh in die Notaufnahme.
👉 Du musst nichts erklären oder begründen. Sag einfach, dass du dich in einer Krise befindest – die Rettungsleitstelle weiß, was zu tun ist.
Notaufnahme im Krankenhaus
Wenn du dich in einer akuten psychischen Krise befindest kannst du jederzeit in die Notaufnahme eines Krankenhauses gehen.
👉 Sag dort einfach, dass du in einer seelischen Krise bist. Du wirst ernst genommen und bekommst ärztliche und psychologische Hilfe – auch nachts oder am Wochenende.